




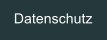






anwaltliche Kosten
Hier finden Sie einen Überblick über entstehende Kosten
Für fast alle Mandanten ist die Frage, welche Kosten eine anwaltliche Vertretung mit sich
bringt sehr entscheidend bei der Frage, ob ein Rechtsanwalt beauftragt werden soll.
Es gibt grundsätzlich drei Varianten:
1. Die sog. Honorarvereinbarung:
Hier legen Mandant und Rechtsanwalt selbst im Rahmen einer sog. Vergütungsvereinbarung fest, was für welche Leistung bezahlt wird. Oft geschieht dieses auf der Basis eines sog. Stundensatzes pro Stunde. Je nach der Komplexität des Falls und
bezahlt wird. Oft geschieht dieses auf der Basis eines sog. Stundensatzes pro Stunde. Je nach der Komplexität des Falls und der schwere des Rechtsgebietes kann dieser niedrig oder hoch sein.
der schwere des Rechtsgebietes kann dieser niedrig oder hoch sein.  2. Die Abrechnung gemäß dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)
Der deutsche Gesetzgeber hat für die Vergütung von Rechtsanwälten ein eigenes Gesetz geschaffen, das sog.
2. Die Abrechnung gemäß dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)
Der deutsche Gesetzgeber hat für die Vergütung von Rechtsanwälten ein eigenes Gesetz geschaffen, das sog. Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Dieses wird auch insbesondere von den Rechtsschutzversicherungen zur Grundlage der
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Dieses wird auch insbesondere von den Rechtsschutzversicherungen zur Grundlage der Abrechnung benutzt. Das RVG unterscheidet insbesondere zwei Bereiche.
Abrechnung benutzt. Das RVG unterscheidet insbesondere zwei Bereiche.  a) Einmal die Abrechnung nach dem sog. Gegenstandswert, d.h. welches Interesse hat der Mandant in dieser Angelegenheit.
a) Einmal die Abrechnung nach dem sog. Gegenstandswert, d.h. welches Interesse hat der Mandant in dieser Angelegenheit. Einfach ist die Frage dann zu beantworten wenn der Mandant von jemanden z.B. 1.000,-- € fordert, dann ist sein Interesse an
Einfach ist die Frage dann zu beantworten wenn der Mandant von jemanden z.B. 1.000,-- € fordert, dann ist sein Interesse an dem Fall genau 1.000,-- €. Nun erhält der Anwalt jedoch nicht auch 1.000,-- € für seine Vergütung, sondern in einer Tabelle
dem Fall genau 1.000,-- €. Nun erhält der Anwalt jedoch nicht auch 1.000,-- € für seine Vergütung, sondern in einer Tabelle zum RVG wird zu diesem Gegenstandwert, dann eine gesonderte anwaltliche Gebühr in Bezug gesetzt. Hier wären das dann
zum RVG wird zu diesem Gegenstandwert, dann eine gesonderte anwaltliche Gebühr in Bezug gesetzt. Hier wären das dann 80,-- €. Diese Gebühr wird dann mit einen Faktor multipliziert, welcher den Umfang und die Schwierigkeit der Angelegenheit
80,-- €. Diese Gebühr wird dann mit einen Faktor multipliziert, welcher den Umfang und die Schwierigkeit der Angelegenheit widerspiegeln soll. Im außergerichtlichen Bereich ist das meistens der Faktor 1,3 bei mittleren Umfang und Schwierigkeit des
widerspiegeln soll. Im außergerichtlichen Bereich ist das meistens der Faktor 1,3 bei mittleren Umfang und Schwierigkeit des Falls. Dies würde in meinem Beispielfall bedeuten, dass wenn der Anwalt z.B. eine Akte anlegt, ein außergerichtliches
Falls. Dies würde in meinem Beispielfall bedeuten, dass wenn der Anwalt z.B. eine Akte anlegt, ein außergerichtliches Schreiben an den Gegner verfasst, z.B. in Form einer Mahnung über 1.000,-- € und dieses sowie die Antwort der Gegenseite
Schreiben an den Gegner verfasst, z.B. in Form einer Mahnung über 1.000,-- € und dieses sowie die Antwort der Gegenseite an den Mandanten weiterleitet, die sog. Geschäftsgebühr des Anwaltes dann 80,-- € mal 1,3 = 104,-- € ist. Diese Summe ist
an den Mandanten weiterleitet, die sog. Geschäftsgebühr des Anwaltes dann 80,-- € mal 1,3 = 104,-- € ist. Diese Summe ist zunächst ohne Umsatzsteuer berechnet. Hinzu kommt dann eine Pauschale von 20,-- € für Post, Telefon und sonstige
zunächst ohne Umsatzsteuer berechnet. Hinzu kommt dann eine Pauschale von 20,-- € für Post, Telefon und sonstige Kommunikationskosten, womit sich dann ein Nettobetrag von 124,-- € bildet. Diesem Betrag wird dann die Umsatzsteuer von
Kommunikationskosten, womit sich dann ein Nettobetrag von 124,-- € bildet. Diesem Betrag wird dann die Umsatzsteuer von zur Zeit 19 % hinzugefügt und ergibt dann 147,56 € brutto (124,-- € zzgl. 23,56 € Umsatzsteuer). Kommt es zur Klage vor
zur Zeit 19 % hinzugefügt und ergibt dann 147,56 € brutto (124,-- € zzgl. 23,56 € Umsatzsteuer). Kommt es zur Klage vor Gericht entstehen weitere Gebühren noch diesem Muster, wobei es dann auch Regelungen gibt, dass weitere Gebühren nicht
Gericht entstehen weitere Gebühren noch diesem Muster, wobei es dann auch Regelungen gibt, dass weitere Gebühren nicht einfach dazu addiert werden, sondern zum Teil auf bereits entstandene Gebühren angerechnet werden.
einfach dazu addiert werden, sondern zum Teil auf bereits entstandene Gebühren angerechnet werden.  b) Die andere Variante die das RVG kennt ist die sog. Rahmengebühr. Hier gibt das RVG für bestimmte Tätigkeiten des
b) Die andere Variante die das RVG kennt ist die sog. Rahmengebühr. Hier gibt das RVG für bestimmte Tätigkeiten des Rechtsanwaltes einen sog. Gebührenrahmen vor. Zum Beispiel 100,-- € bis 500,-- €. Dieses gilt z.B. für den Bereich des
Rechtsanwaltes einen sog. Gebührenrahmen vor. Zum Beispiel 100,-- € bis 500,-- €. Dieses gilt z.B. für den Bereich des Strafrechtes. Wird der Anwalt bezüglich einer bestimmten Tätigkeit beauftragt, entsteht eine Gebühr zwischen der unteren
Strafrechtes. Wird der Anwalt bezüglich einer bestimmten Tätigkeit beauftragt, entsteht eine Gebühr zwischen der unteren und der oberen Spanne dieses Gebührenrahmens. Maßstab ist auch hier Umfang und juristische Schwierigkeit des Falls. Auch
und der oberen Spanne dieses Gebührenrahmens. Maßstab ist auch hier Umfang und juristische Schwierigkeit des Falls. Auch hier können die Gebühren je nach Stadium des Falls (Tätigkeit gegenüber der Staatsanwaltschaft, Gericht, Wahrnehmung von
hier können die Gebühren je nach Stadium des Falls (Tätigkeit gegenüber der Staatsanwaltschaft, Gericht, Wahrnehmung von Verhandlungsterminen) mehrfach zzgl. der oben genannten Auslagenpauschale für Kommunikationskosten von 20,-- € zzgl.
Verhandlungsterminen) mehrfach zzgl. der oben genannten Auslagenpauschale für Kommunikationskosten von 20,-- € zzgl. Umsatzsteuer anfallen.
3. Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe
Es gibt für Mandanten, welche die anwaltlichen Gebühren nicht selbst aufbringen können finanzielle Hilfe vom Staat.
Umsatzsteuer anfallen.
3. Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe
Es gibt für Mandanten, welche die anwaltlichen Gebühren nicht selbst aufbringen können finanzielle Hilfe vom Staat. Zunächst vorweg zu den Begriffen. Beratungshilfe nach dem Beratungshilfegesetz betrifft nur ein außergerichtliches
Zunächst vorweg zu den Begriffen. Beratungshilfe nach dem Beratungshilfegesetz betrifft nur ein außergerichtliches Tätigwerden des Anwaltes. Kommt es zu einem gerichtlichen Prozess kommt die Prozesskostenhilfe zum tragen. Wichtig ist,
Tätigwerden des Anwaltes. Kommt es zu einem gerichtlichen Prozess kommt die Prozesskostenhilfe zum tragen. Wichtig ist, dass beides zwei getrennte Angelegenheiten sind. Erhält man Beratungshilfe bewilligt bedeutet dieses nicht automatisch,
dass beides zwei getrennte Angelegenheiten sind. Erhält man Beratungshilfe bewilligt bedeutet dieses nicht automatisch, dass man damit auch eine Vertretung im gerichtlichen Verfahren finanziert bekommt. Beides muss natürlich zeitlich abgestuft
dass man damit auch eine Vertretung im gerichtlichen Verfahren finanziert bekommt. Beides muss natürlich zeitlich abgestuft gesondert beantragt und bewilligt werden. Hier sind zwei Besonderheiten zu beachten. Beratungshilfe setzt meist zumutbare
gesondert beantragt und bewilligt werden. Hier sind zwei Besonderheiten zu beachten. Beratungshilfe setzt meist zumutbare eigene Bemühungen voraus ein Problem mit der Gegenseite zu lösen, d.h. der Anwalt soll nicht nur einfach zur Beantwortung
eigene Bemühungen voraus ein Problem mit der Gegenseite zu lösen, d.h. der Anwalt soll nicht nur einfach zur Beantwortung von Briefen beauftragt werden. Es muss sich um ein juristischen Problem handeln, für welches der Rechtsrat eines Anwaltes
von Briefen beauftragt werden. Es muss sich um ein juristischen Problem handeln, für welches der Rechtsrat eines Anwaltes notwendig ist und der Rechtsunkundige sonst in der Sache nicht weiter kommt. Bei der Prozesskostenhilfe ist auch zu
notwendig ist und der Rechtsunkundige sonst in der Sache nicht weiter kommt. Bei der Prozesskostenhilfe ist auch zu beachten, dass das Gericht bei der Bewilligung neben der finanziellen Bedürftigkeit des Antragstellers auch die
beachten, dass das Gericht bei der Bewilligung neben der finanziellen Bedürftigkeit des Antragstellers auch die Erfolgsaussichten der angestrengten Klage prüft. Dieses bedeutet, dass wenn die Klage von vornherein kaum Aussicht auf
Erfolgsaussichten der angestrengten Klage prüft. Dieses bedeutet, dass wenn die Klage von vornherein kaum Aussicht auf Erfolg hätte, die Bewilligung von Prozesskostenhilfe auch daran scheitern kann.
Erfolg hätte, die Bewilligung von Prozesskostenhilfe auch daran scheitern kann.  Dieses soll nur eine ganz kurze Einführung sein, welche keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.
Dieses soll nur eine ganz kurze Einführung sein, welche keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. 
 bezahlt wird. Oft geschieht dieses auf der Basis eines sog. Stundensatzes pro Stunde. Je nach der Komplexität des Falls und
bezahlt wird. Oft geschieht dieses auf der Basis eines sog. Stundensatzes pro Stunde. Je nach der Komplexität des Falls und der schwere des Rechtsgebietes kann dieser niedrig oder hoch sein.
der schwere des Rechtsgebietes kann dieser niedrig oder hoch sein.  2. Die Abrechnung gemäß dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)
Der deutsche Gesetzgeber hat für die Vergütung von Rechtsanwälten ein eigenes Gesetz geschaffen, das sog.
2. Die Abrechnung gemäß dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)
Der deutsche Gesetzgeber hat für die Vergütung von Rechtsanwälten ein eigenes Gesetz geschaffen, das sog. Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Dieses wird auch insbesondere von den Rechtsschutzversicherungen zur Grundlage der
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Dieses wird auch insbesondere von den Rechtsschutzversicherungen zur Grundlage der Abrechnung benutzt. Das RVG unterscheidet insbesondere zwei Bereiche.
Abrechnung benutzt. Das RVG unterscheidet insbesondere zwei Bereiche.  a) Einmal die Abrechnung nach dem sog. Gegenstandswert, d.h. welches Interesse hat der Mandant in dieser Angelegenheit.
a) Einmal die Abrechnung nach dem sog. Gegenstandswert, d.h. welches Interesse hat der Mandant in dieser Angelegenheit. Einfach ist die Frage dann zu beantworten wenn der Mandant von jemanden z.B. 1.000,-- € fordert, dann ist sein Interesse an
Einfach ist die Frage dann zu beantworten wenn der Mandant von jemanden z.B. 1.000,-- € fordert, dann ist sein Interesse an dem Fall genau 1.000,-- €. Nun erhält der Anwalt jedoch nicht auch 1.000,-- € für seine Vergütung, sondern in einer Tabelle
dem Fall genau 1.000,-- €. Nun erhält der Anwalt jedoch nicht auch 1.000,-- € für seine Vergütung, sondern in einer Tabelle zum RVG wird zu diesem Gegenstandwert, dann eine gesonderte anwaltliche Gebühr in Bezug gesetzt. Hier wären das dann
zum RVG wird zu diesem Gegenstandwert, dann eine gesonderte anwaltliche Gebühr in Bezug gesetzt. Hier wären das dann 80,-- €. Diese Gebühr wird dann mit einen Faktor multipliziert, welcher den Umfang und die Schwierigkeit der Angelegenheit
80,-- €. Diese Gebühr wird dann mit einen Faktor multipliziert, welcher den Umfang und die Schwierigkeit der Angelegenheit widerspiegeln soll. Im außergerichtlichen Bereich ist das meistens der Faktor 1,3 bei mittleren Umfang und Schwierigkeit des
widerspiegeln soll. Im außergerichtlichen Bereich ist das meistens der Faktor 1,3 bei mittleren Umfang und Schwierigkeit des Falls. Dies würde in meinem Beispielfall bedeuten, dass wenn der Anwalt z.B. eine Akte anlegt, ein außergerichtliches
Falls. Dies würde in meinem Beispielfall bedeuten, dass wenn der Anwalt z.B. eine Akte anlegt, ein außergerichtliches Schreiben an den Gegner verfasst, z.B. in Form einer Mahnung über 1.000,-- € und dieses sowie die Antwort der Gegenseite
Schreiben an den Gegner verfasst, z.B. in Form einer Mahnung über 1.000,-- € und dieses sowie die Antwort der Gegenseite an den Mandanten weiterleitet, die sog. Geschäftsgebühr des Anwaltes dann 80,-- € mal 1,3 = 104,-- € ist. Diese Summe ist
an den Mandanten weiterleitet, die sog. Geschäftsgebühr des Anwaltes dann 80,-- € mal 1,3 = 104,-- € ist. Diese Summe ist zunächst ohne Umsatzsteuer berechnet. Hinzu kommt dann eine Pauschale von 20,-- € für Post, Telefon und sonstige
zunächst ohne Umsatzsteuer berechnet. Hinzu kommt dann eine Pauschale von 20,-- € für Post, Telefon und sonstige Kommunikationskosten, womit sich dann ein Nettobetrag von 124,-- € bildet. Diesem Betrag wird dann die Umsatzsteuer von
Kommunikationskosten, womit sich dann ein Nettobetrag von 124,-- € bildet. Diesem Betrag wird dann die Umsatzsteuer von zur Zeit 19 % hinzugefügt und ergibt dann 147,56 € brutto (124,-- € zzgl. 23,56 € Umsatzsteuer). Kommt es zur Klage vor
zur Zeit 19 % hinzugefügt und ergibt dann 147,56 € brutto (124,-- € zzgl. 23,56 € Umsatzsteuer). Kommt es zur Klage vor Gericht entstehen weitere Gebühren noch diesem Muster, wobei es dann auch Regelungen gibt, dass weitere Gebühren nicht
Gericht entstehen weitere Gebühren noch diesem Muster, wobei es dann auch Regelungen gibt, dass weitere Gebühren nicht einfach dazu addiert werden, sondern zum Teil auf bereits entstandene Gebühren angerechnet werden.
einfach dazu addiert werden, sondern zum Teil auf bereits entstandene Gebühren angerechnet werden.  b) Die andere Variante die das RVG kennt ist die sog. Rahmengebühr. Hier gibt das RVG für bestimmte Tätigkeiten des
b) Die andere Variante die das RVG kennt ist die sog. Rahmengebühr. Hier gibt das RVG für bestimmte Tätigkeiten des Rechtsanwaltes einen sog. Gebührenrahmen vor. Zum Beispiel 100,-- € bis 500,-- €. Dieses gilt z.B. für den Bereich des
Rechtsanwaltes einen sog. Gebührenrahmen vor. Zum Beispiel 100,-- € bis 500,-- €. Dieses gilt z.B. für den Bereich des Strafrechtes. Wird der Anwalt bezüglich einer bestimmten Tätigkeit beauftragt, entsteht eine Gebühr zwischen der unteren
Strafrechtes. Wird der Anwalt bezüglich einer bestimmten Tätigkeit beauftragt, entsteht eine Gebühr zwischen der unteren und der oberen Spanne dieses Gebührenrahmens. Maßstab ist auch hier Umfang und juristische Schwierigkeit des Falls. Auch
und der oberen Spanne dieses Gebührenrahmens. Maßstab ist auch hier Umfang und juristische Schwierigkeit des Falls. Auch hier können die Gebühren je nach Stadium des Falls (Tätigkeit gegenüber der Staatsanwaltschaft, Gericht, Wahrnehmung von
hier können die Gebühren je nach Stadium des Falls (Tätigkeit gegenüber der Staatsanwaltschaft, Gericht, Wahrnehmung von Verhandlungsterminen) mehrfach zzgl. der oben genannten Auslagenpauschale für Kommunikationskosten von 20,-- € zzgl.
Verhandlungsterminen) mehrfach zzgl. der oben genannten Auslagenpauschale für Kommunikationskosten von 20,-- € zzgl. Umsatzsteuer anfallen.
3. Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe
Es gibt für Mandanten, welche die anwaltlichen Gebühren nicht selbst aufbringen können finanzielle Hilfe vom Staat.
Umsatzsteuer anfallen.
3. Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe
Es gibt für Mandanten, welche die anwaltlichen Gebühren nicht selbst aufbringen können finanzielle Hilfe vom Staat. Zunächst vorweg zu den Begriffen. Beratungshilfe nach dem Beratungshilfegesetz betrifft nur ein außergerichtliches
Zunächst vorweg zu den Begriffen. Beratungshilfe nach dem Beratungshilfegesetz betrifft nur ein außergerichtliches Tätigwerden des Anwaltes. Kommt es zu einem gerichtlichen Prozess kommt die Prozesskostenhilfe zum tragen. Wichtig ist,
Tätigwerden des Anwaltes. Kommt es zu einem gerichtlichen Prozess kommt die Prozesskostenhilfe zum tragen. Wichtig ist, dass beides zwei getrennte Angelegenheiten sind. Erhält man Beratungshilfe bewilligt bedeutet dieses nicht automatisch,
dass beides zwei getrennte Angelegenheiten sind. Erhält man Beratungshilfe bewilligt bedeutet dieses nicht automatisch, dass man damit auch eine Vertretung im gerichtlichen Verfahren finanziert bekommt. Beides muss natürlich zeitlich abgestuft
dass man damit auch eine Vertretung im gerichtlichen Verfahren finanziert bekommt. Beides muss natürlich zeitlich abgestuft gesondert beantragt und bewilligt werden. Hier sind zwei Besonderheiten zu beachten. Beratungshilfe setzt meist zumutbare
gesondert beantragt und bewilligt werden. Hier sind zwei Besonderheiten zu beachten. Beratungshilfe setzt meist zumutbare eigene Bemühungen voraus ein Problem mit der Gegenseite zu lösen, d.h. der Anwalt soll nicht nur einfach zur Beantwortung
eigene Bemühungen voraus ein Problem mit der Gegenseite zu lösen, d.h. der Anwalt soll nicht nur einfach zur Beantwortung von Briefen beauftragt werden. Es muss sich um ein juristischen Problem handeln, für welches der Rechtsrat eines Anwaltes
von Briefen beauftragt werden. Es muss sich um ein juristischen Problem handeln, für welches der Rechtsrat eines Anwaltes notwendig ist und der Rechtsunkundige sonst in der Sache nicht weiter kommt. Bei der Prozesskostenhilfe ist auch zu
notwendig ist und der Rechtsunkundige sonst in der Sache nicht weiter kommt. Bei der Prozesskostenhilfe ist auch zu beachten, dass das Gericht bei der Bewilligung neben der finanziellen Bedürftigkeit des Antragstellers auch die
beachten, dass das Gericht bei der Bewilligung neben der finanziellen Bedürftigkeit des Antragstellers auch die Erfolgsaussichten der angestrengten Klage prüft. Dieses bedeutet, dass wenn die Klage von vornherein kaum Aussicht auf
Erfolgsaussichten der angestrengten Klage prüft. Dieses bedeutet, dass wenn die Klage von vornherein kaum Aussicht auf Erfolg hätte, die Bewilligung von Prozesskostenhilfe auch daran scheitern kann.
Erfolg hätte, die Bewilligung von Prozesskostenhilfe auch daran scheitern kann.  Dieses soll nur eine ganz kurze Einführung sein, welche keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.
Dieses soll nur eine ganz kurze Einführung sein, welche keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. 
Michael Engel Anwalt für Strafrecht - Verkehrsrecht - Wettbewerbsrecht - Markenrecht
in Berlin Reinickendorf







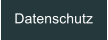



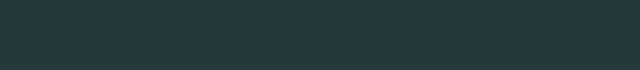
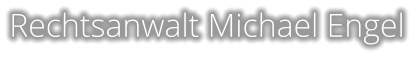

anwaltliche Kosten
Hier finden Sie einen Überblick über entstehende Kosten
Für fast alle Mandanten ist die Frage, welche Kosten eine anwaltliche Vertretung mit sich
bringt sehr entscheidend bei der Frage, ob ein Rechtsanwalt beauftragt werden soll.
Es gibt grundsätzlich drei Varianten:
1. Die sog. Honorarvereinbarung:
Hier legen Mandant und Rechtsanwalt selbst im Rahmen einer sog.
Vergütungsvereinbarung fest, was für welche Leistung bezahlt wird. Oft geschieht dieses
auf der Basis eines sog. Stundensatzes pro Stunde. Je nach der Komplexität des Falls
und der schwere des Rechtsgebietes kann dieser niedrig oder hoch sein.
2. Die Abrechnung gemäß dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)
Der deutsche Gesetzgeber hat für die Vergütung von Rechtsanwälten ein eigenes Gesetz
geschaffen, dass sog. Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Dieses wird auch insbesondere
von den Rechtsschutzversicherungen zur Grundlage der Abrechnung benutzt. Das RVG
unterscheidet insbesondere zwei Bereiche.
a) Einmal die Abrechnung nach dem sog. Gegenstandswert, d.h. welches Interesse hat
der Mandant in dieser Angelegenheit. Einfach ist die Frage dann zu beantworten wenn
der Mandant von jemanden z.B. 1.000,-- € fordert, dann ist sein Interesse an dem Fall
genau 1.000,-- €. Nun erhält der Anwalt jedoch nicht auch 1.000,-- € für seine Vergütung,
sondern in einer Tabelle zum RVG wird zu diesem Gegenstandwert, dann eine
gesonderte anwaltliche Gebühr in Bezug gesetzt. Hier wären dass dann 80,-- €. Diese
Gebühr wird dann mit einen Faktor multipliziert, welcher den Umfang und die
Schwierigkeit der Angelegenheit widerspiegeln soll. Im außergerichtlichen Bereich ist das
meistens der Faktor 1,3 bei mittleren Umfang und Schwierigkeit des Falls. Dies würde in
meinem Beispielfall bedeuten, dass wenn der Anwalt z.B. eine Akte anlegt, ein
außergerichtliches Schreiben an den Gegner verfasst, z.B. in Form einer Mahnung über
1.000,-- € und dieses sowie die Antwort der Gegenseite an den Mandanten weiterleitet,
die sog. Geschäftsgebühr des Anwaltes dann 80,-- € mal 1,3 = 104,-- € ist. Diese Summe
ist zunächst ohne Umsatzsteuer berechnet. Hinzu kommt dann eine Pauschale von 20,--
€ für Post, Telefon und sonstige Kommunikationskosten, womit sich dann ein
Nettobetrag von 124,-- € bildet. Diesem Betrag wird dann die Umsatzsteuer von zur Zeit
19 % hinzugefügt und ergibt dann 147,56 € brutto (124,-- € zzgl. 23,56 € Umsatzsteuer).
Kommt es zur Klage vor Gericht entstehen weitere Gebühren noch diesem Muster,
wobei es dann auch Regelungen gibt, dass weitere Gebühren nicht einfach dazu addiert
werden, sondern zum Teil auf bereits entstandene Gebühren angerechnet werden.
b) Die andere Variante die das RVG kennt ist die sog. Rahmengebühr. Hier gibt das RVG
für bestimmte Tätigkeiten des Rechtsanwaltes einen sog. Gebührenrahmen vor. Zum
Beispiel 100,-- € bis 500,-- €. Dieses gilt z.B. für den Bereich des Strafrechtes. Wird der
Anwalt bezüglich einer bestimmten Tätigkeit beauftragt, entsteht eine Gebühr zwischen
der unteren und der oberen Spanne dieses Gebührenrahmens. Maßstab ist auch hier
Umfang und juristische Schwierigkeit des Falls. Auch hier können die Gebühren je nach
Stadium des Falls (Tätigkeit gegenüber der Staatsanwaltschaft, Gericht, Wahrnehmung
von Verhandlungsterminen) mehrfach zzgl. der oben genannten Auslagenpauschale für
Kommunikationskosten von 20,-- € zzgl. Umsatzsteuer anfallen.
3. Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe
Es gibt für Mandanten, welche die anwaltlichen Gebühren nicht selbst aufbringen
können finanzielle Hilfe vom Staat. Zunächst vorweg zu den Begriffen. Beratungshilfe
nach dem Beratungshilfegesetz betrifft nur ein außergerichtliches Tätigwerden des
Anwaltes. Kommt es zu einem gerichtlichen Prozess kommt die Prozesskostenhilfe zum
tragen. Wichtig ist, dass beides zwei getrennte Angelegenheiten sind. Erhält man
Beratungshilfe bewilligt bedeutet dieses nicht automatisch, dass man damit auch eine
Vertretung im gerichtlichen Verfahren finanziert bekommt. Beides muss natürlich
zeitlich abgestuft gesondert beantragt und bewilligt werden. Hier sind zwei
Besonderheiten zu beachten. Beratungshilfe setzt meist zumutbare eigene
Bemühungen voraus ein Problem mit der Gegenseite zu lösen, d.h. der Anwalt soll nicht
nur einfach zur Beantwortung von Briefen beauftragt werden. Es muss sich um ein
juristischen Problem handeln, für welches der Rechtsrat eines Anwaltes notwendig ist
und der Rechtsunkundige sonst in der Sache nicht weiter kommt. Bei der
Prozesskostenhilfe ist auch zu beachten, dass das Gericht bei der Bewilligung neben der
finanziellen Bedürftigkeit des Antragstellers auch die Erfolgsaussichten der
angestrengten Klage prüft. Dieses bedeutet, dass wenn die Klage von vornherein kaum
Aussicht auf Erfolg hätte, die Bewilligung von Prozesskostenhilfe auch daran scheitern
kann.
Dieses soll nur eine ganz kurze Einführung sein, welche keinen Anspruch auf
Vollständigkeit erhebt.







anwaltliche Kosten
Hier finden Sie einen Überblick
1. Die sog. Honorarvereinbarung:
Hier legen Mandant und Rechtsanwalt selbst im Rahmen einer sog.
Vergütungsvereinbarung fest, was für welche Leistung bezahlt wird. Oft
geschieht dieses auf der Basis eines sog. Stundensatzes pro Stunde. Je
nach der Komplexität des Falls und der schwere des Rechtsgebietes kann
dieser niedrig oder hoch sein.
2. Die Abrechnung gemäß dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)
Der deutsche Gesetzgeber hat für die Vergütung von Rechtsanwälten ein
eigenes Gesetz geschaffen, dass sog. Rechtsanwaltsvergütungsgesetz.
Dieses wird auch insbesondere von den Rechtsschutzversicherungen zur
Grundlage der Abrechnung benutzt. Das RVG unterscheidet
insbesondere zwei Bereiche.
a) Einmal die Abrechnung nach dem sog. Gegenstandswert, d.h. welches
Interesse hat der Mandant in dieser Angelegenheit. Einfach ist die Frage
dann zu beantworten wenn der Mandant von jemanden z.B. 1.000,-- €
fordert, dann ist sein Interesse an dem Fall genau 1.000,-- €. Nun erhält
der Anwalt jedoch nicht auch 1.000,-- € für seine Vergütung, sondern in
einer Tabelle zum RVG wird zu diesem Gegenstandwert, dann eine
gesonderte anwaltliche Gebühr in Bezug gesetzt. Hier wären dass dann
80,-- €. Diese Gebühr wird dann mit einen Faktor multipliziert, welcher
den Umfang und die Schwierigkeit der Angelegenheit widerspiegeln soll.
Im außergerichtlichen Bereich ist das meistens der Faktor 1,3 bei
mittleren Umfang und Schwierigkeit des Falls. Dies würde in meinem
Beispielfall bedeuten, dass wenn der Anwalt z.B. eine Akte anlegt, ein
außergerichtliches Schreiben an den Gegner verfasst, z.B. in Form einer
Mahnung über 1.000,-- € und dieses sowie die Antwort der Gegenseite
an den Mandanten weiterleitet, die sog. Geschäftsgebühr des Anwaltes
dann 80,-- € mal 1,3 = 104,-- € ist. Diese Summe ist zunächst ohne
Umsatzsteuer berechnet. Hinzu kommt dann eine Pauschale von 20,-- €
für Post, Telefon und sonstige Kommunikationskosten, womit sich dann
ein Nettobetrag von 124,-- € bildet. Diesem Betrag wird dann die
Umsatzsteuer von zur Zeit 19 % hinzugefügt und ergibt dann 147,56 €
brutto (124,-- € zzgl. 23,56 € Umsatzsteuer). Kommt es zur Klage vor
Gericht entstehen weitere Gebühren noch diesem Muster, wobei es
dann auch Regelungen gibt, dass weitere Gebühren nicht einfach dazu
addiert werden, sondern zum Teil auf bereits entstandene Gebühren
angerechnet werden.
b) Die andere Variante die das RVG kennt ist die sog. Rahmengebühr.
Hier gibt das RVG für bestimmte Tätigkeiten des Rechtsanwaltes einen
sog. Gebührenrahmen vor. Zum Beispiel 100,-- € bis 500,-- €. Dieses gilt
z.B. für den Bereich des Strafrechtes. Wird der Anwalt bezüglich einer
bestimmten Tätigkeit beauftragt, entsteht eine Gebühr zwischen der
unteren und der oberen Spanne dieses Gebührenrahmens. Maßstab ist
auch hier Umfang und juristische Schwierigkeit des Falls. Auch hier
können die Gebühren je nach Stadium des Falls (Tätigkeit gegenüber der
Staatsanwaltschaft, Gericht, Wahrnehmung von Verhandlungsterminen)
mehrfach zzgl. der oben genannten Auslagenpauschale für
Kommunikationskosten von 20,-- € zzgl. Umsatzsteuer anfallen.
3. Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe
Es gibt für Mandanten, welche die anwaltlichen Gebühren nicht selbst
aufbringen können finanzielle Hilfe vom Staat. Zunächst vorweg zu den
Begriffen. Beratungshilfe nach dem Beratungshilfegesetz betrifft nur ein
außergerichtliches Tätigwerden des Anwaltes. Kommt es zu einem
gerichtlichen Prozess kommt die Prozesskostenhilfe zum tragen. Wichtig
ist, dass beides zwei getrennte Angelegenheiten sind. Erhält man
Beratungshilfe bewilligt bedeutet dieses nicht automatisch, dass man
damit auch eine Vertretung im gerichtlichen Verfahren finanziert
bekommt. Beides muss natürlich zeitlich abgestuft gesondert beantragt
und bewilligt werden. Hier sind zwei Besonderheiten zu beachten.
Beratungshilfe setzt meist zumutbare eigene Bemühungen voraus ein
Problem mit der Gegenseite zu lösen, d.h. der Anwalt soll nicht nur
einfach zur Beantwortung von Briefen beauftragt werden. Es muss sich
um ein juristischen Problem handeln, für welches der Rechtsrat eines
Anwaltes notwendig ist und der Rechtsunkundige sonst in der Sache
nicht weiter kommt. Bei der Prozesskostenhilfe ist auch zu beachten,
dass das Gericht bei der Bewilligung neben der finanziellen Bedürftigkeit
des Antragstellers auch die Erfolgsaussichten der angestrengten Klage
prüft. Dieses bedeutet, dass wenn die Klage von vornherein kaum
Aussicht auf Erfolg hätte, die Bewilligung von Prozesskostenhilfe auch
daran scheitern kann.
Dieses soll nur eine ganz kurze Einführung sein, welche keinen Anspruch
auf Vollständigkeit erhebt.












